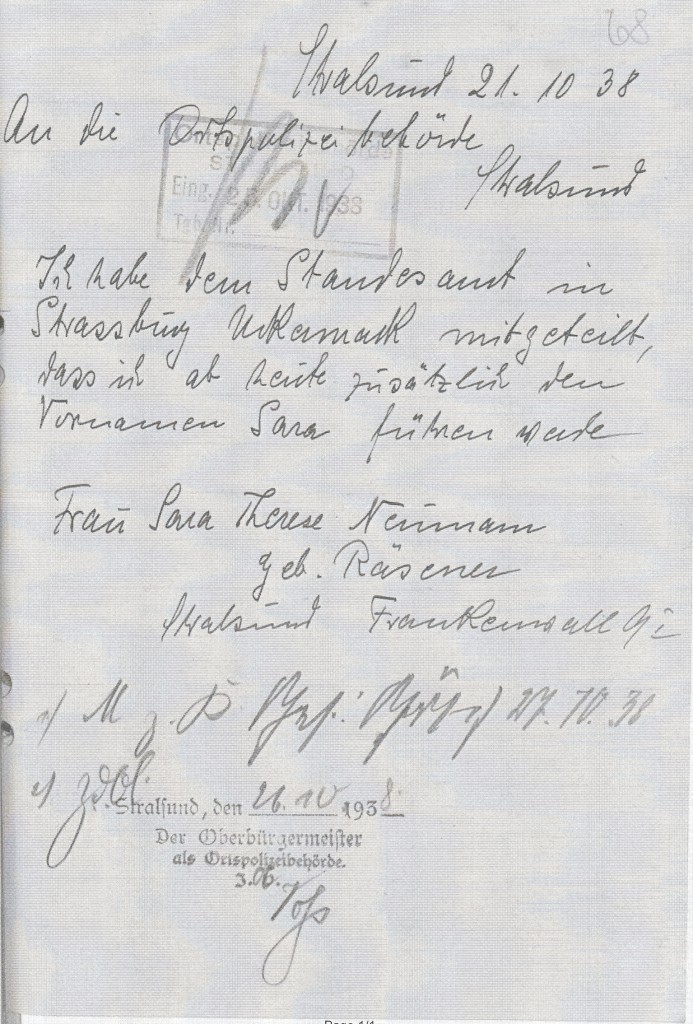
Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 18, Nr. 440
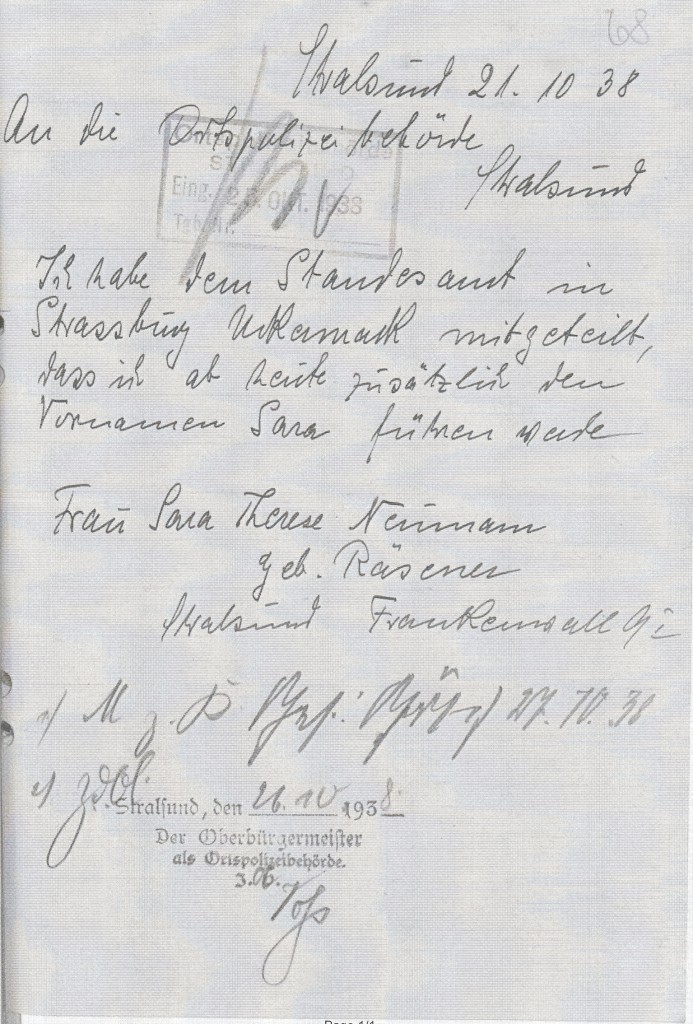
Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 18, Nr. 440
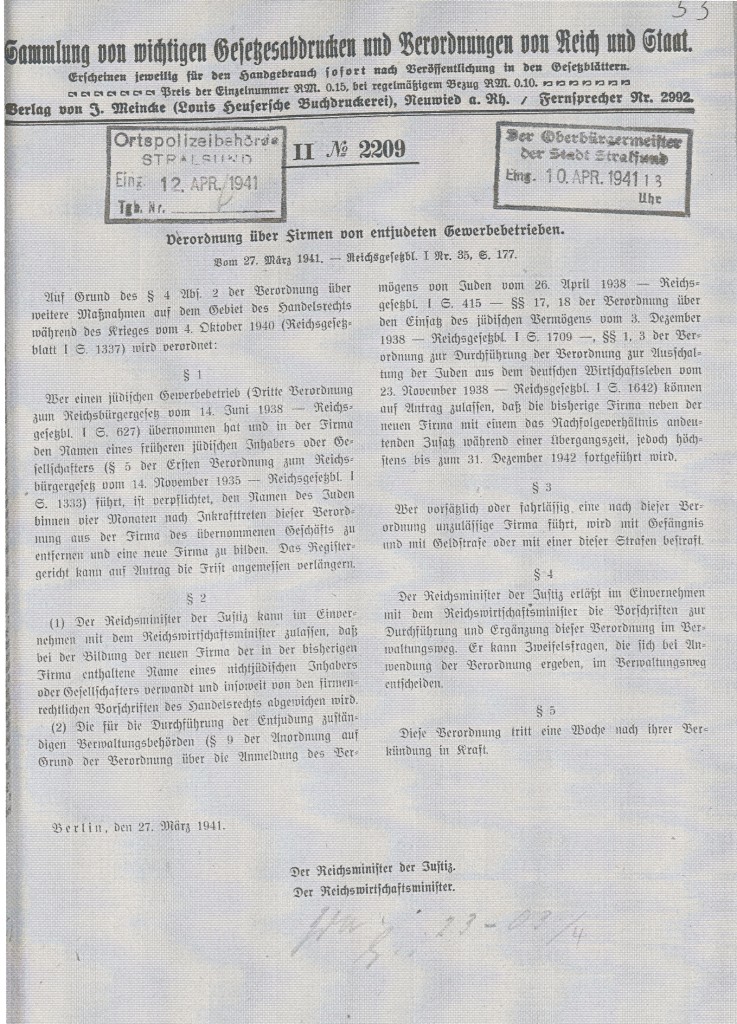
Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 18, Nr. 433

Quelle: Friederike Fechner
Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 18, Nr. 434
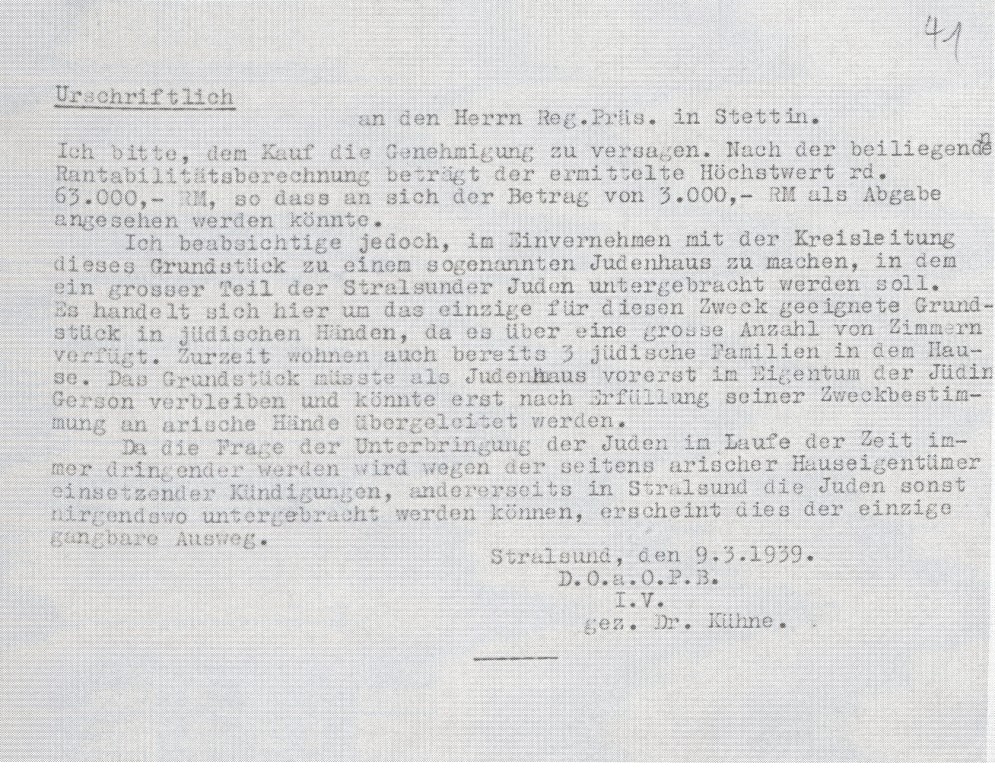
Quelle_Stadtarchiv Stralsund, Rep. 24, Nr. 4588
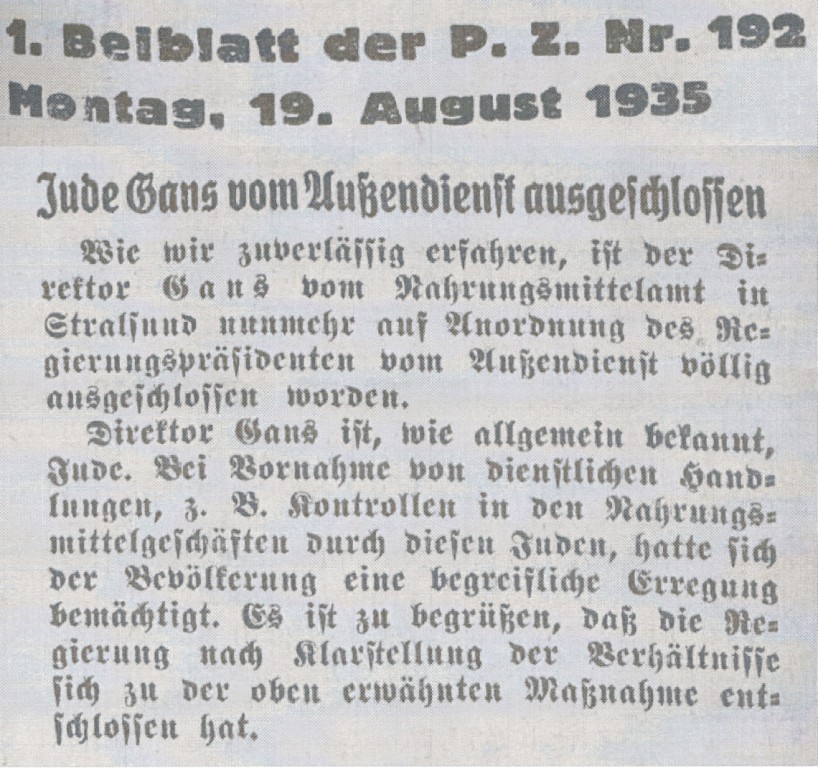
Quelle_Stadtarchiv Stralsund

Quelle_Stadtarchiv Stralsund